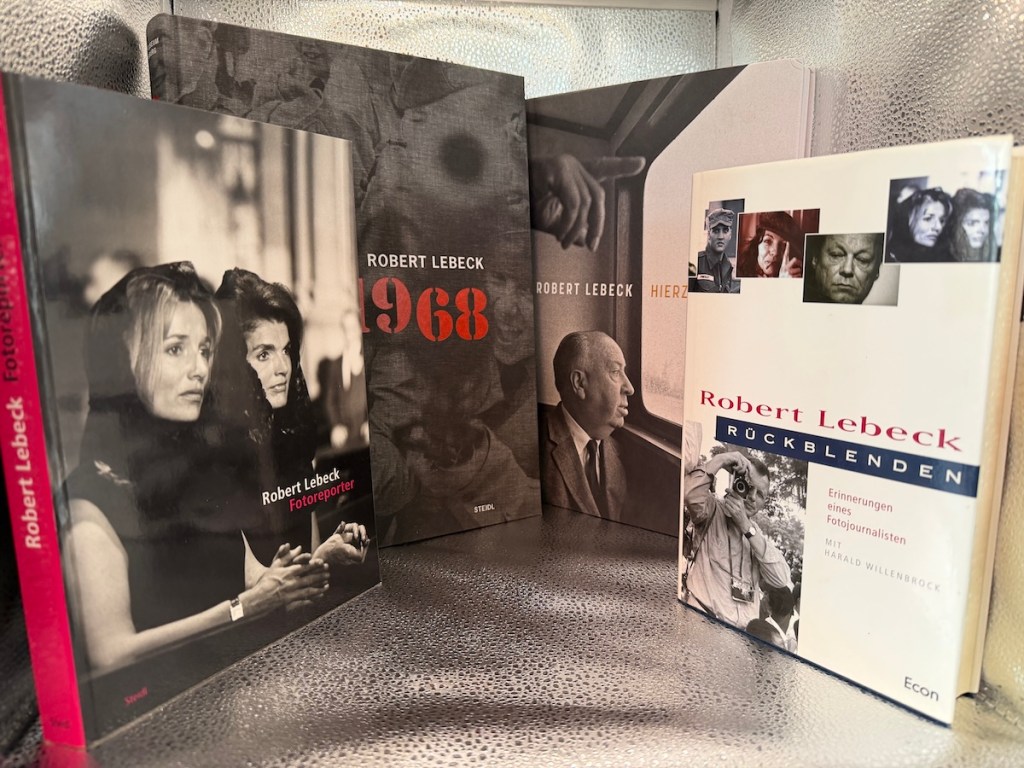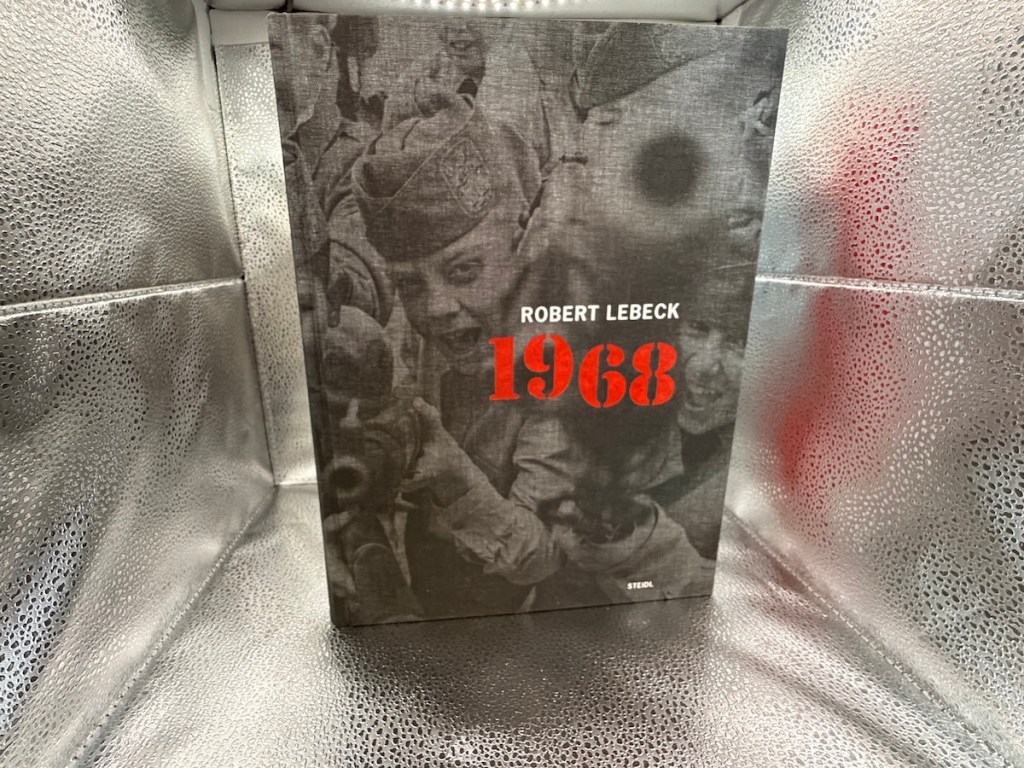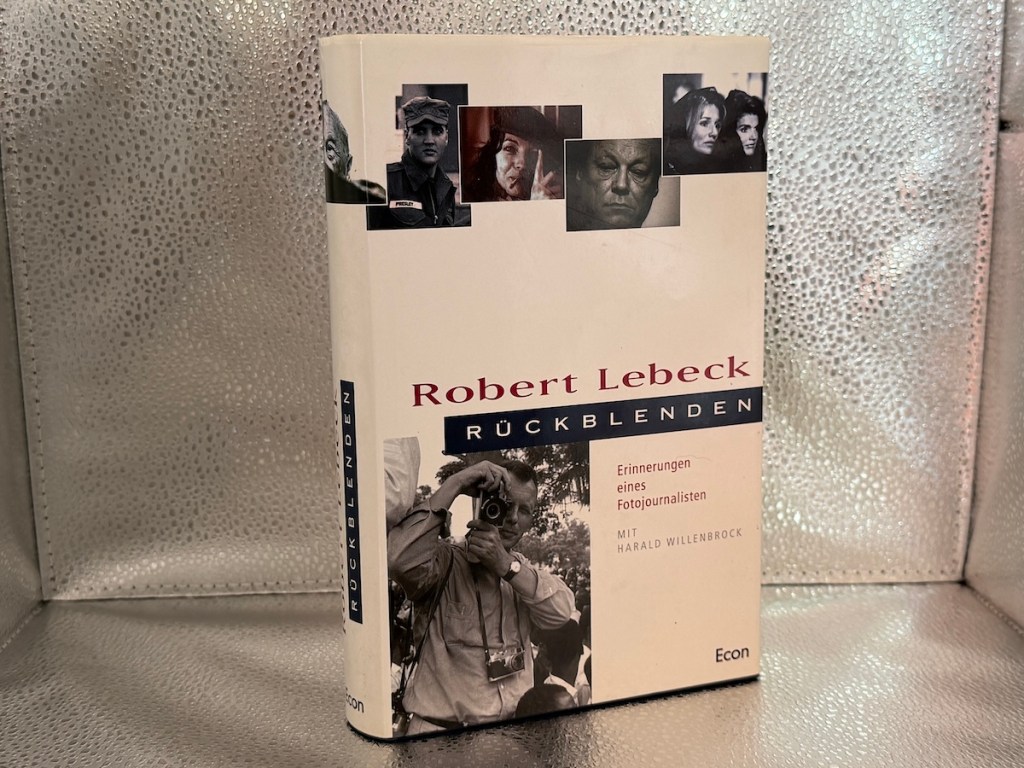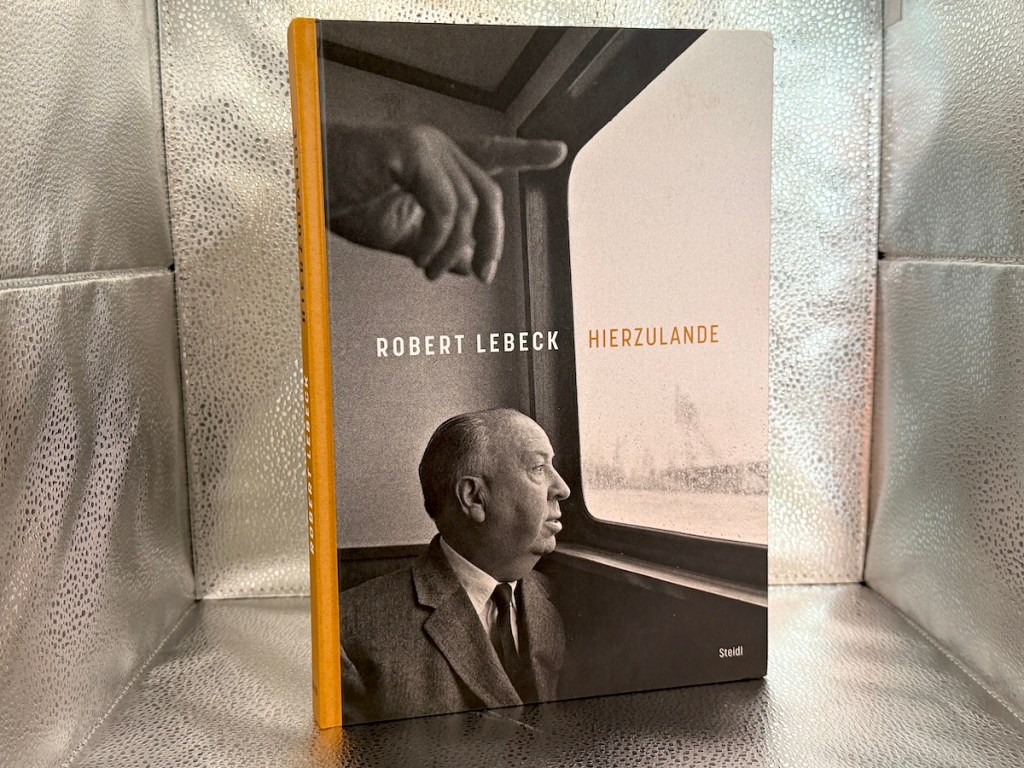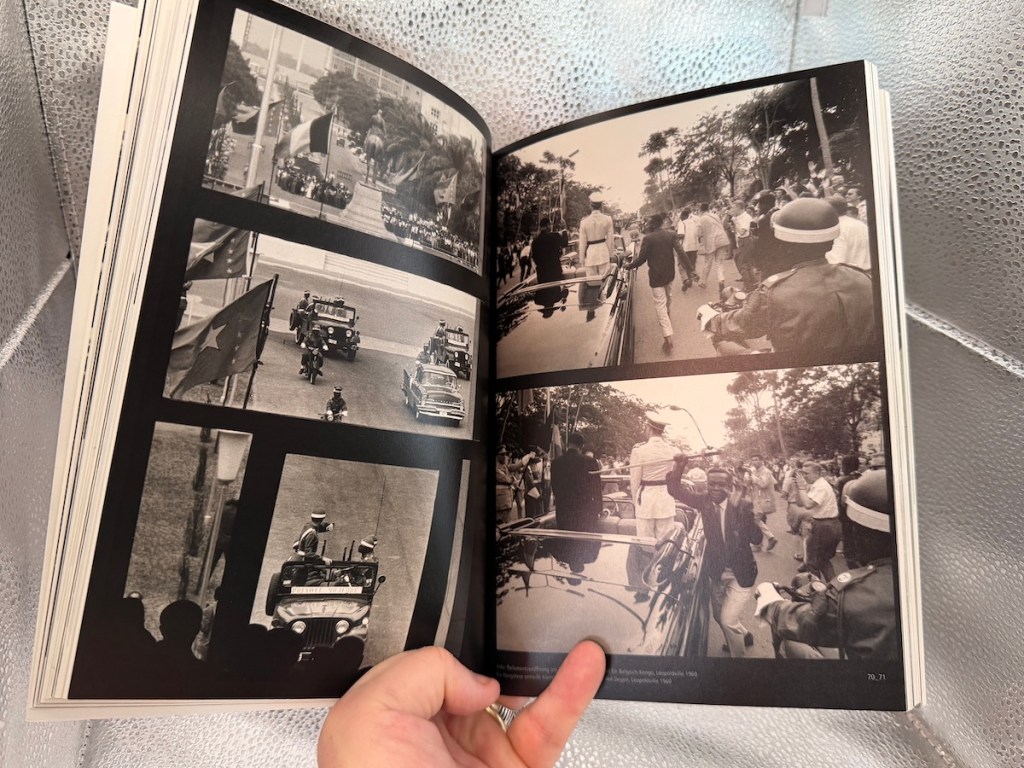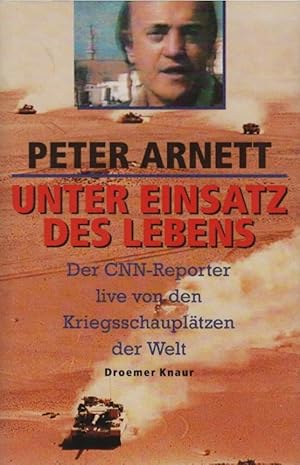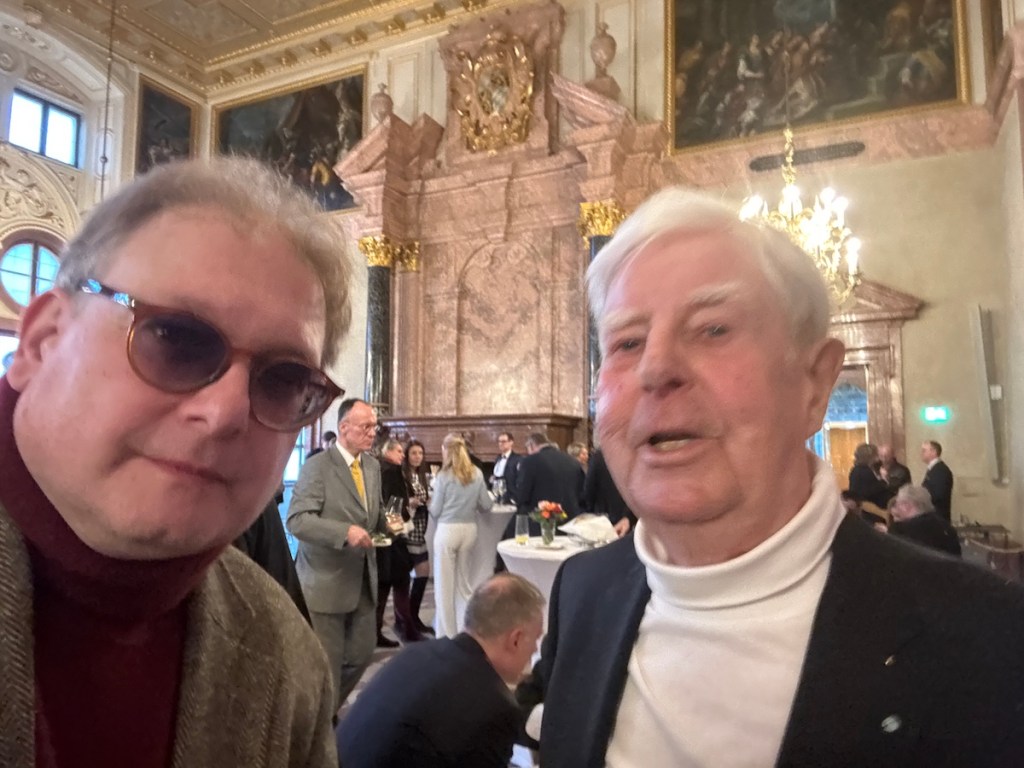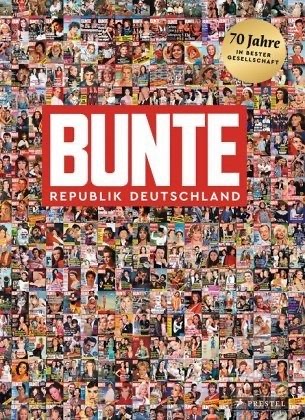Der Besuch der Retrogame Börse 2026 in Garching fühlte sich für mich als Retrogamer an wie eine Zeitreise, bei der man nicht nur schaut, sondern wieder mit allen Sinnen eintaucht. Schon beim Betreten der Halle lag dieser unverwechselbare Mix aus Karton, Plastik und Elektronik in der Luft – der Geruch von Modulen, die Jahrzehnte überdauert haben, und von Konsolen, die einst ganze Nachmittage verschluckten.

An den Tischen reihten sich C64-Disketten neben NES-Cartridges, liebevoll sortierte Mega-Drive-Boxen neben zerlesenen Spielehandbüchern. Ich war vor allem auf der Suche nach Atari 2600 und PSP-Spielen. Händler und Sammler kamen ins Gespräch, fachsimpelten über Revisionen von Platinen, über vergilbte oder perfekt erhaltene Gehäuse, über Spiele, die man jahrelang gesucht hatte und nun plötzlich in greifbarer Nähe sah. Der Sohn beauftragte mich, mit dem Kauf von seltenen Pokémon-Spielen, während die Tochter nach japanischen Spielen suchte, obwohl wir bisher noch keine japanische Sega Saturn besitzen. So sind wir Retrogamer.
Begeistert traf ich auf Oliver Reynolds vom Verein Videospielkultur VSK und bekam eine Einladung zu einem der nächsten Spieleabende in der Gamerei. Als VSK noch im Werk 1 war, besuchten mein Sohn und ich regelmäßig die Institution. Diese Tradition werden wir jetzt wieder aufnehmen.

Was diese Börse so besonders machte, war nicht allein das Kaufen und Verkaufen. Es war das gemeinsame Erinnern. Viele Besucher erzählten sich Geschichten von verpassten Schulbussen, weil ein Bossgegner einfach nicht fallen wollte, oder von Familienfernsehern, die abends zum Schlachtfeld um den letzten freien Joystick wurden. Retrovideogames zeigten sich hier als Kulturgut: als Zeugnisse einer Zeit, in der technische Grenzen Kreativität erzwangen und wenige Pixel ausreichten, um ganze Welten entstehen zu lassen. Jedes Spiel war ein kleines Stück Mediengeschichte, ein Beleg dafür, wie Erzählformen, Musik und Grafik sich gegenseitig beeinflussten und eine eigene Ästhetik entwickelten.
Dies bestätigte auch der Organisator der Veranstaltung Bernd Kühn im Interview.
Zwischen Röhrenmonitoren mit flimmernden Scanlines und dem vertrauten Klicken alter Controller wurde klar, warum die Faszination bis heute anhält. Retrogames sind nicht nur Nostalgieobjekte, sondern kulturelle Artefakte, die von gesellschaftlichen Stimmungen, technischen Umbrüchen und dem Spieltrieb ganzer Generationen erzählen. Die Retrogame Börse 2026 in Garching machte genau das spürbar: dass diese Spiele mehr sind als Unterhaltung – sie sind Erinnerungsräume, die bewahrt, geteilt und immer wieder neu entdeckt werden wollen.






Videogames sind ein Kulturgut, weil sie weit über ihren ursprünglichen Zweck als bloße Unterhaltung hinausgewachsen sind. Sie sind Ausdruck ihrer Zeit, Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen und ein eigenständiges Medium mit eigenen ästhetischen, erzählerischen und technischen Gesetzmäßigkeiten. Wie Literatur, Film oder Musik entstehen Videogames nie im luftleeren Raum. Sie werden von Menschen geschaffen, die von politischen, sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen geprägt sind, und tragen diese Einflüsse in sich – manchmal offen, manchmal subtil.






Ein zentrales Merkmal von Videogames als Kulturgut ist ihre Fähigkeit, Geschichten interaktiv zu erzählen. Anders als bei linearen Medien wird der Mensch vor dem Bildschirm nicht nur zum Beobachter, sondern zum handelnden Teil der Erzählung. Entscheidungen, Scheitern, Erfolg und Wiederholung sind nicht bloß erzählerische Motive, sondern Erfahrungen, die aktiv durchlebt werden. Dadurch entsteht eine besondere emotionale Bindung: Spiele prägen Erinnerungen, Haltungen und manchmal sogar Werte. Viele Menschen können sich Jahre später noch an bestimmte Spielmomente erinnern – nicht, weil sie sie gesehen haben, sondern weil sie sie selbst erlebt haben. Bei mir war es der Angriff der Walker in Empire strikes Back von Parker für das Atari 2600.
Hinzu kommt die künstlerische Dimension. Grafikstile, Musik, Sounddesign und Spielmechaniken bilden eine eigene Form von Ästhetik. Gerade frühe Videogames zeigen eindrucksvoll, wie technische Begrenzungen kreative Lösungen hervorgebracht haben. Wenige Farben, einfache Klänge und minimale Rechenleistung führten nicht zu Armut, sondern zu einer klaren, wiedererkennbaren Formsprache, die bis heute zitiert und weiterentwickelt wird. Diese Gestaltung ist vergleichbar mit Kunstströmungen anderer Medien, die ebenfalls aus Einschränkungen heraus entstanden sind.










Videogames sind außerdem ein wichtiges technikhistorisches Zeugnis. Sie dokumentieren den Fortschritt von Hard- und Software, von einfachen Pixelgrafiken bis zu komplexen, offenen Welten. Gleichzeitig erzählen sie von der zunehmenden Digitalisierung des Alltags. Wer alte Spiele betrachtet, sieht nicht nur Spielideen, sondern auch den Stand der Technik, die Bedienkonzepte und das Verhältnis des Menschen zur Maschine in einer bestimmten Epoche. In diesem Sinne sind Spiele Quellen der Zeitgeschichte.
Nicht zuletzt haben Videogames eine starke soziale und gemeinschaftliche Dimension. Sie prägen Generationen, schaffen gemeinsame Referenzen und eine geteilte Erinnerungskultur. Ob auf dem Pausenhof, im Jugendzimmer oder heute online: Spiele waren und sind Orte des Austauschs, des Wettbewerbs und der Zusammenarbeit. Communities, Modifikationen, Speedruns oder Let’s Plays zeigen, dass Spiele nicht abgeschlossen sind, sondern weiterleben, interpretiert und neu angeeignet werden – ein klassisches Merkmal von lebendigem Kulturgut.
Dass Videogames heute in Museen ausgestellt, wissenschaftlich erforscht und archiviert werden, ist daher folgerichtig. Sie erzählen Geschichten über uns selbst: über unsere Wünsche, Ängste, unseren Spieltrieb und unseren Umgang mit Technik. Als Schnittstelle von Kunst, Technologie und Gesellschaft sind Videogames ein prägendes Kulturgut des 20. und 21. Jahrhunderts – und ein kulturelles Gedächtnis, das es zu bewahren gilt.