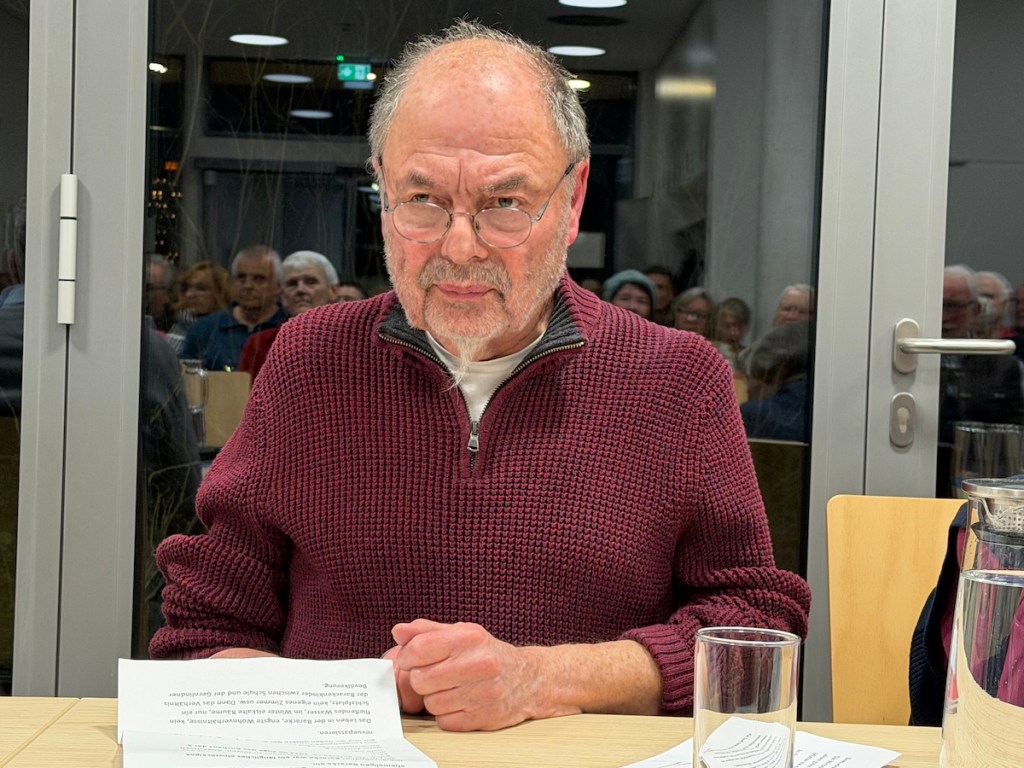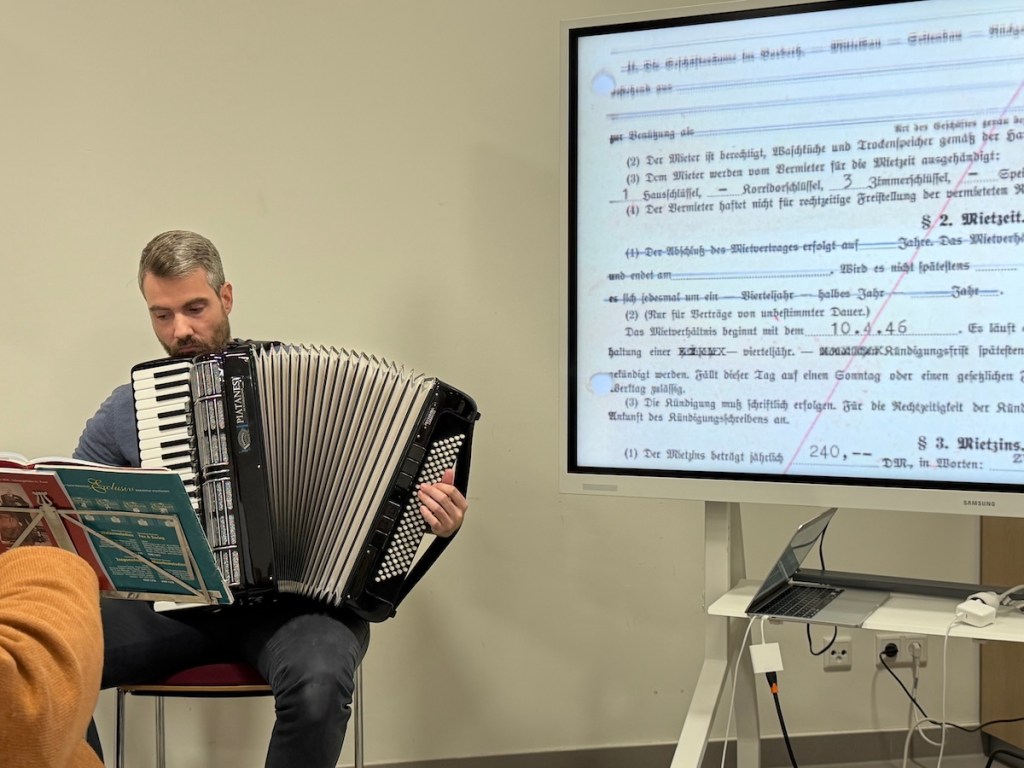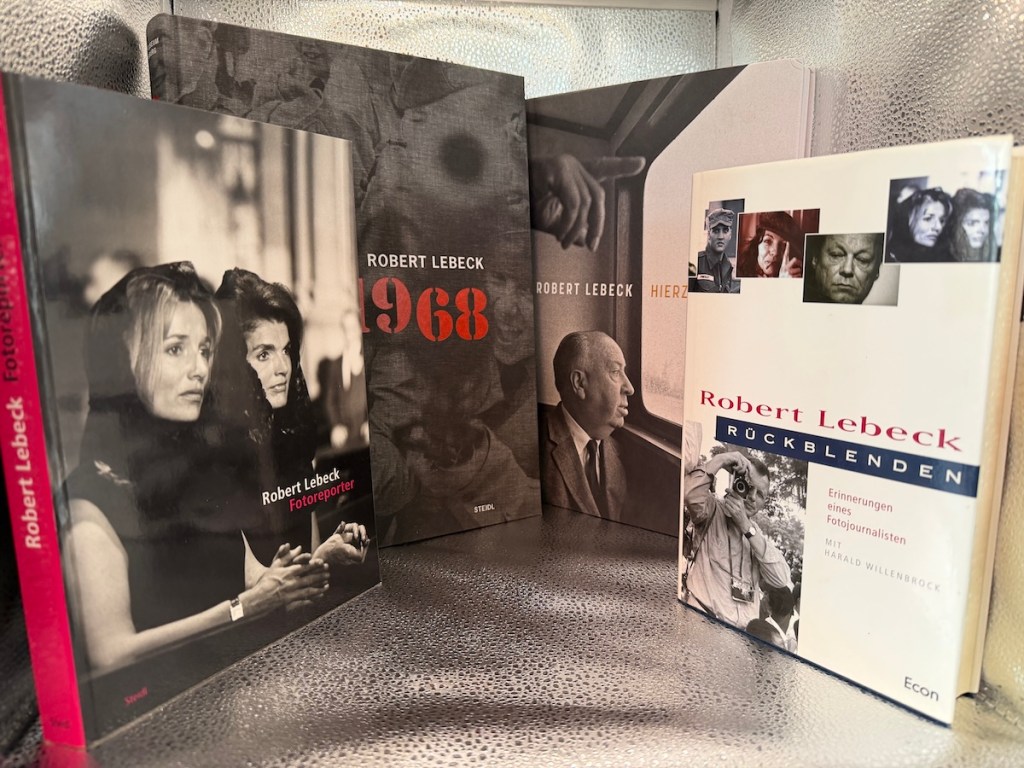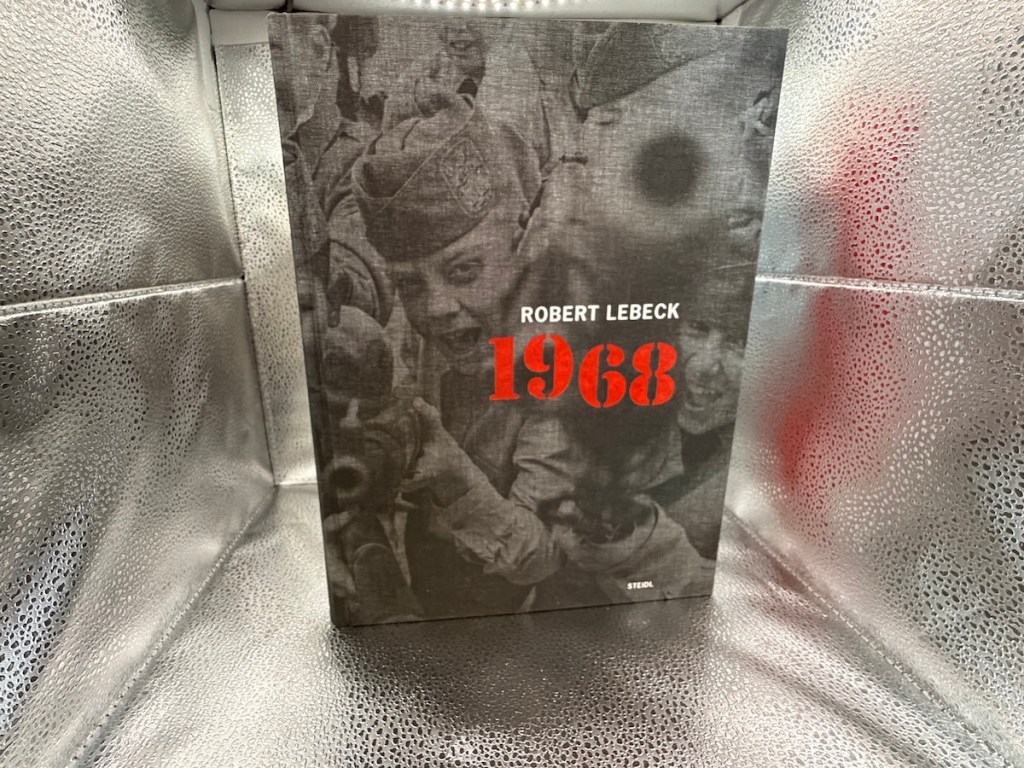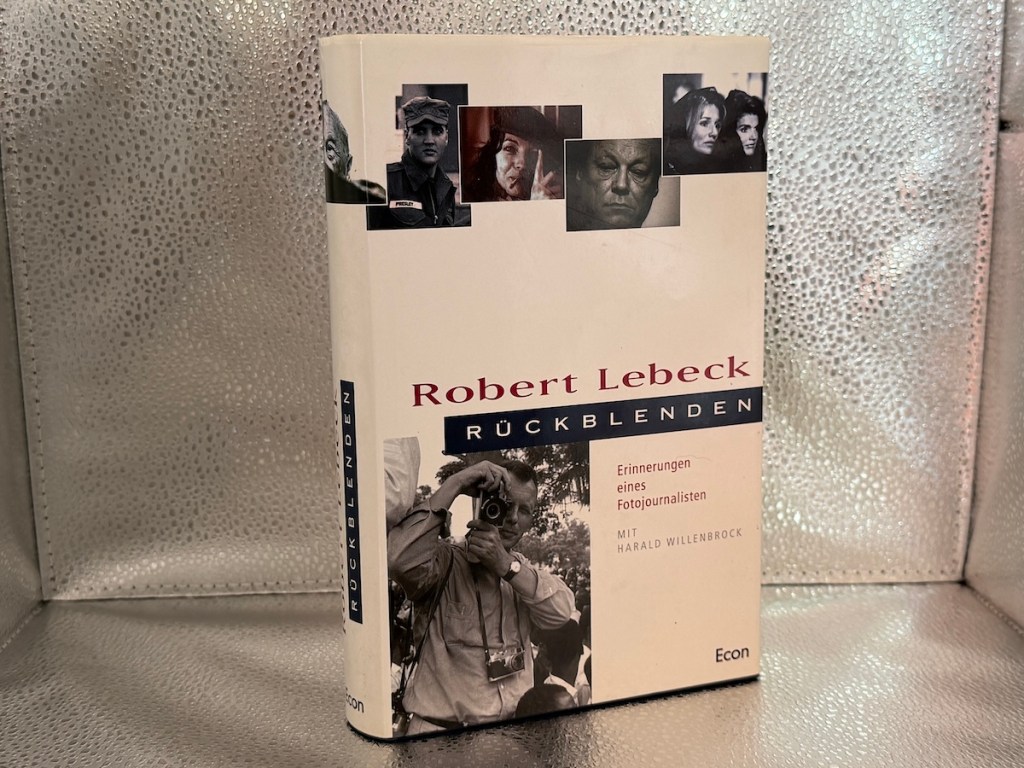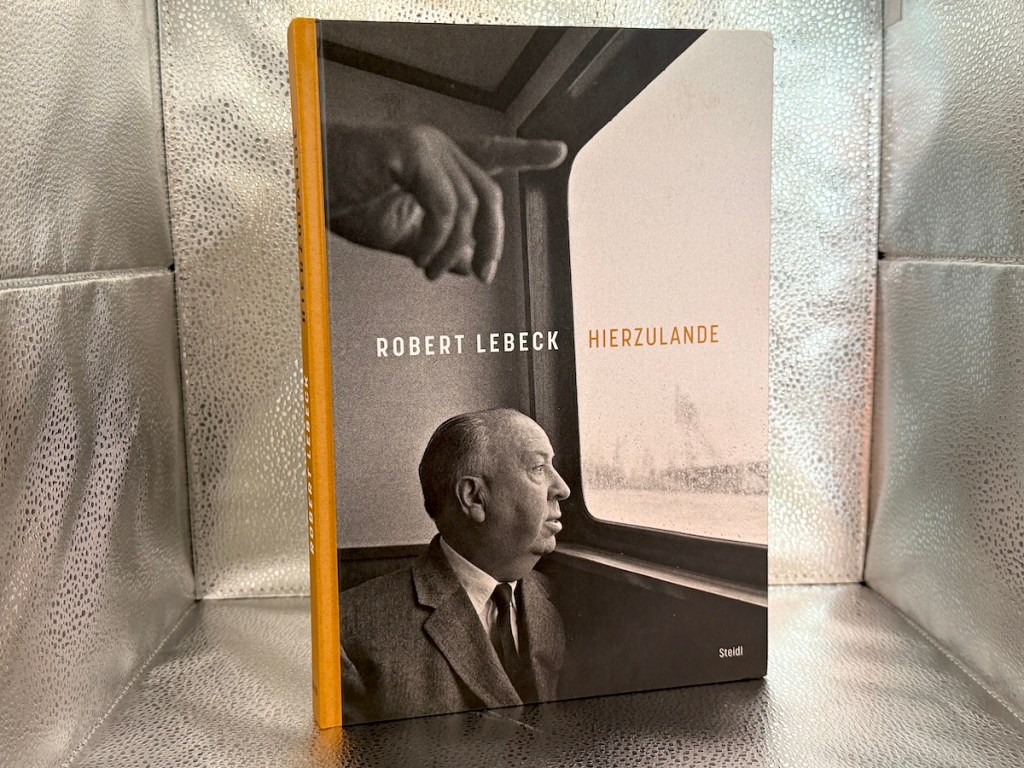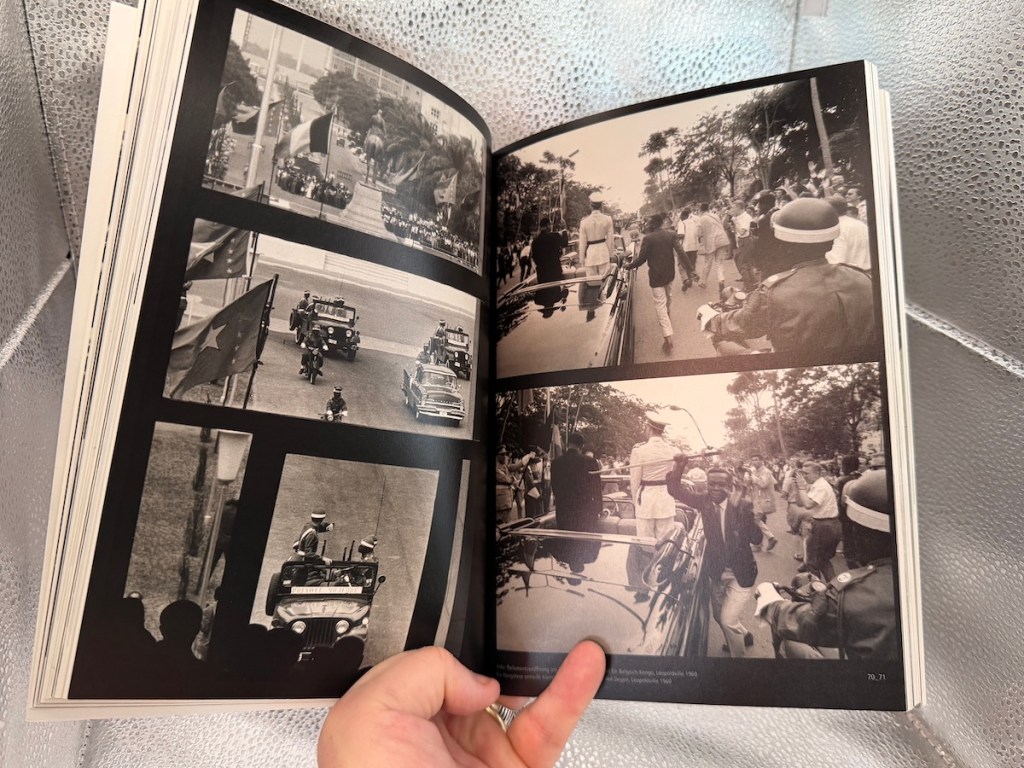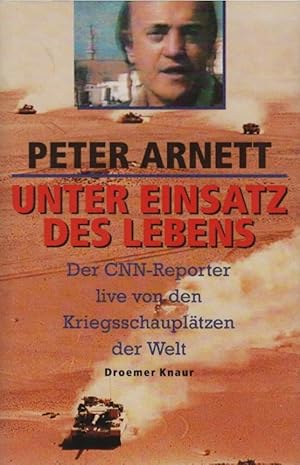Wikipedia ist 25 Jahre alt geworden – und steht zugleich so stabil wie nie zuvor im Netz und doch unter einem neuen, subtilen Druck durch KI, der weniger technisch als kulturell ist. Die Plattform ist zum unsichtbaren Rückgrat der Wissensinfrastruktur geworden, während KI-Systeme beginnen, genau dieses Rückgrat zu überblenden und zu vereinnahmen.

Seit dem 15. Januar 2001 hat sich Wikipedia von einem anarchisch wirkenden Freiwilligenprojekt zu einer globalen Referenzmaschine entwickelt, auf die sich Schulen, Redaktionen, Suchmaschinen und längst auch große Sprachmodelle stützen. In über 300 Sprachen, mit mehr als 65 Millionen Artikeln, bildet sie eine Art evidenzbasiertes Grundrauschen, gegen das sich jede Behauptung im Netz zumindest gedanklich messen lassen muss. Dieser Erfolg ist paradoxerweise genau das Einfallstor für jene KI-Dienste, die ihren Nutzerinnen und Nutzern in Sekundenbruchteilen Antworten liefern, ohne noch sichtbar zu machen, dass in ihrem Schatten eine ehrenamtliche Infrastruktur aus Menschen steht, die seit Jahrzehnten Quellen prüfen, editieren, streiten, löschen, belegen.
Am 15. Januar 2001 startete Gründer Jimmy Wales an seinem Windows-Rechner nicht nur das Projekt selbst, sondern legte auch unmittelbar die ersten Einträge der Online-Enzyklopädie an. Bereits am ersten Tag entstanden Artikelseiten zu Begriffen wie WikiPedia, PhilosophyAndLogic und UnitedStates, und nur fünf Tage später waren schon mehr als 100 Einträge verfügbar. Eine Übersicht der ersten 100 über Wikipedia abrufbaren Seiten zeigt, wie rasant sich das Projekt entwickelte: Anfangs ausschließlich englischsprachig, folgte schon kurz darauf der erste Ableger in einer anderen Sprache. Nur zwei Monate nach dem Start der englischen Version ging am 16. März 2001 die deutsche Wikipedia als erste lokale Variante online. Ich habe auch meinen Beitrag geleistet und Artikel verfasst. Heute umfasst die englischsprachige Originalseite mehr als sieben Millionen Artikel, während die deutsche Wikipedia mit über drei Millionen Einträgen ebenfalls eine beeindruckende Informationsfülle bereithält. Ein zentraler Aspekt bleibt dabei die Finanzierung des Projekts: Neben den vertrauten Spendenaufrufen gibt es zum Jubiläum im Wikipedia Store eine Sonderkollektion, deren Erlöse die Arbeit an der Enzyklopädie unterstützen sollen.

In den Reaktionen auf das Jubiläum spiegelt sich die besondere Rolle, die Wikipedia im digitalen Alltag vieler Menschen einnimmt. Nutzerinnen und Nutzer gratulieren, bezeichnen die Plattform als bevorzugte Informationsquelle und hoffen, dass sie sich erfolgreich an neue Rahmenbedingungen anpassen wird. Zugleich tauchen in den Kommentaren auch kritische Stimmen auf, die von Zensur sprechen oder auf Filterblasen hinweisen, während andere dem widersprechen und die Moderation als notwendigen Teil der Qualitätssicherung sehen. Immer wieder wird betont, wie wichtig regelmäßige Spenden sind, um Wikipedia langfristig zu erhalten, und auf eine Easter-Egg-Seite zum Jubiläum hingewiesen. Denn wenn Menschen sagen, sie würden etwas „googeln“, landen sie meist – oft unbewusst – bei Wikipedia, sei es über die ersten Treffer in Suchmaschinen, über Instant Answers oder über Antworten von LLM-Chatbots, die ebenfalls auf diese Inhalte zurückgreifen. Fiele Wikipedia plötzlich weg, wüsste das Web spürbar weniger, lautet der warnende Unterton, verbunden mit dem Appell, zu spenden, bevor dieses Fundament des Wissens verschwindet.
Die Bedrohung für die Reichweite von Wikipedia durch KI ist daher weniger ein plötzlicher Exodus der Leserschaft als eine schleichende Umleitung der Aufmerksamkeit: Wenn Chatbots Fragen direkt beantworten, entfällt der Klick auf die Quelle, und damit das, was die Wikipedia schlicht zum Leben braucht – die Begegnung zwischen Text und Leser. Erste Auswertungen deuten auf spürbare Rückgänge beim menschlichen Traffic hin, während der automatisierte Zugriff für Trainingsdaten und Scraping massiv zunimmt, also genau jener Zugriff, der keine Spenden generiert, keine neuen Autoren hervorbringt und keine Diskussionsseiten bevölkert. KI isst sich durch die Wissensbestände, an deren Pflege sie selbst nicht beteiligt ist, und verwandelt das mühselig Kuratierte in einen glattgebügelten, personalisierten Antwortstrom, in dem die ursprünglichen Kontexte, Konflikte und Korrekturen verschwinden.
In dieser Verschiebung liegt auch eine neue Dimension der Verlässlichkeit: Wikipedia hat nie behauptet, unfehlbar zu sein, aber sie ist strukturell überprüfbar – jede Version, jede Quelle, jeder Konflikt ist transparent dokumentiert und im Idealfall rückverfolgbar. Obwohl ich das Gefühl habe, die deutsche Ausgabe der Wikipedia ist zum Teil ideologisch.
Fehler sind hier nicht verborgenes Scheitern, sondern im Grunde Teil einer öffentlichen Lernkurve, die über Edits, Reverts und Diskussionsarchive nachgezeichnet werden kann; das System baut auf Misstrauen als produktiver Kraft, auf der ständigen Möglichkeit der Korrektur. KI-Systeme dagegen präsentieren ihre Ausgaben mit der glatten Souveränität eines fertigen Textes, dessen Herkunft sich bestenfalls in allgemeinen Modellkarten, nicht aber konkret im Satz nachprüfen lässt, und der sich zudem auf Trainingsdaten stützt, deren Lizenzlage und Aktualität häufig unklar bleiben.
Gerade hier verschränken sich Erfolg und Krise: Weil Wikipedia in vielen Bereichen eine der zuverlässigsten offenen Datenquellen geworden ist, fließt sie massenhaft in KI-Modelle ein, die ihr wiederum Nutzer abspenstig machen und einen Teil der Legitimität absorbieren, ohne den Aufwand der Qualitätssicherung zu teilen. Der Unterschied in der Verlässlichkeit ist deshalb nicht nur eine Frage der Fehlerquote, sondern der Verantwortungskette: Wikipedia institutionalisiert Zweifel und kollektive Aushandlung, KI institutionalisiert Plausibilität und Komfort – und je mehr sich die Öffentlichkeit an letzteres gewöhnt, desto größer wird die Gefahr, dass das sichtbare Ringen um Wahrheit, das Wikipedia ausmacht, unter einer Schicht von friktionslosen Antworten verschwindet. In diesem Sinn ist der 25. Geburtstag nicht nur ein Jubiläum, sondern auch eine Erinnerungsmarke: an ein Netz, in dem Wissen als Prozess sichtbar war – und an die Entscheidung, ob man diesen Prozess den Maschinen überlässt oder weiter öffentlich führt.