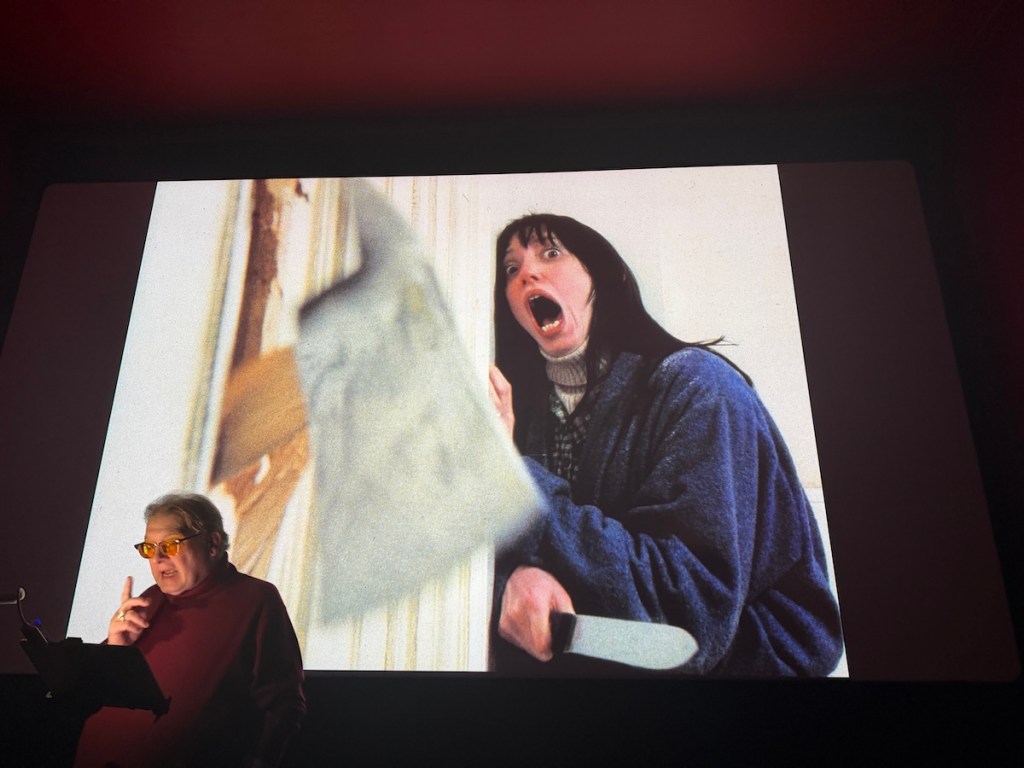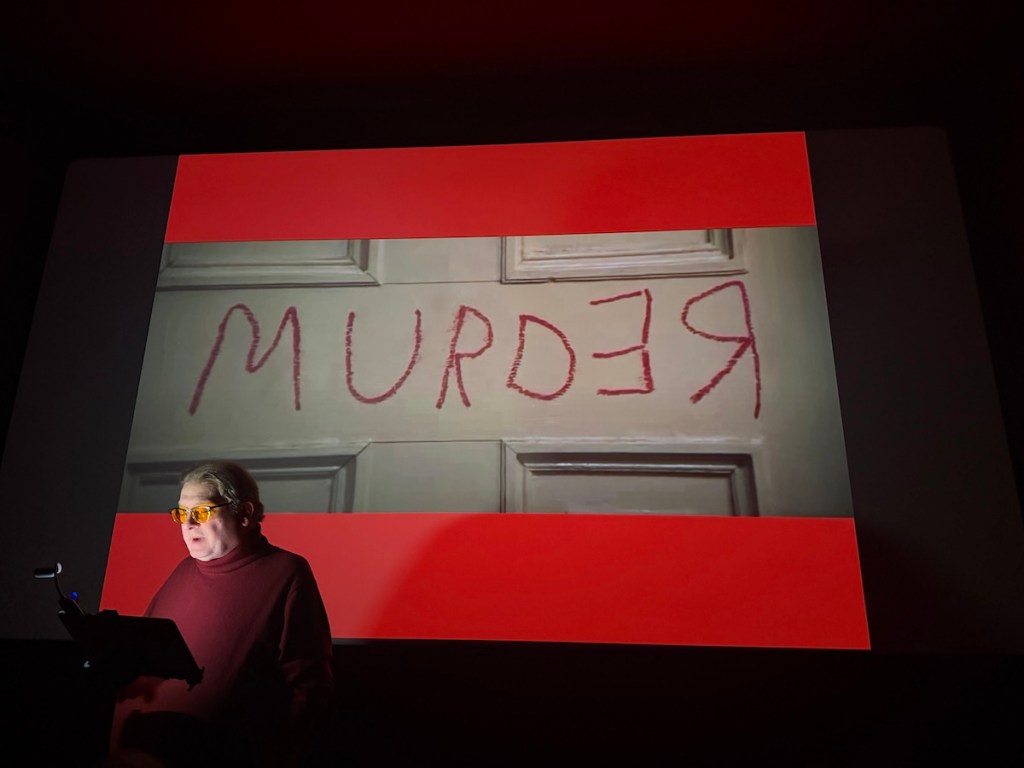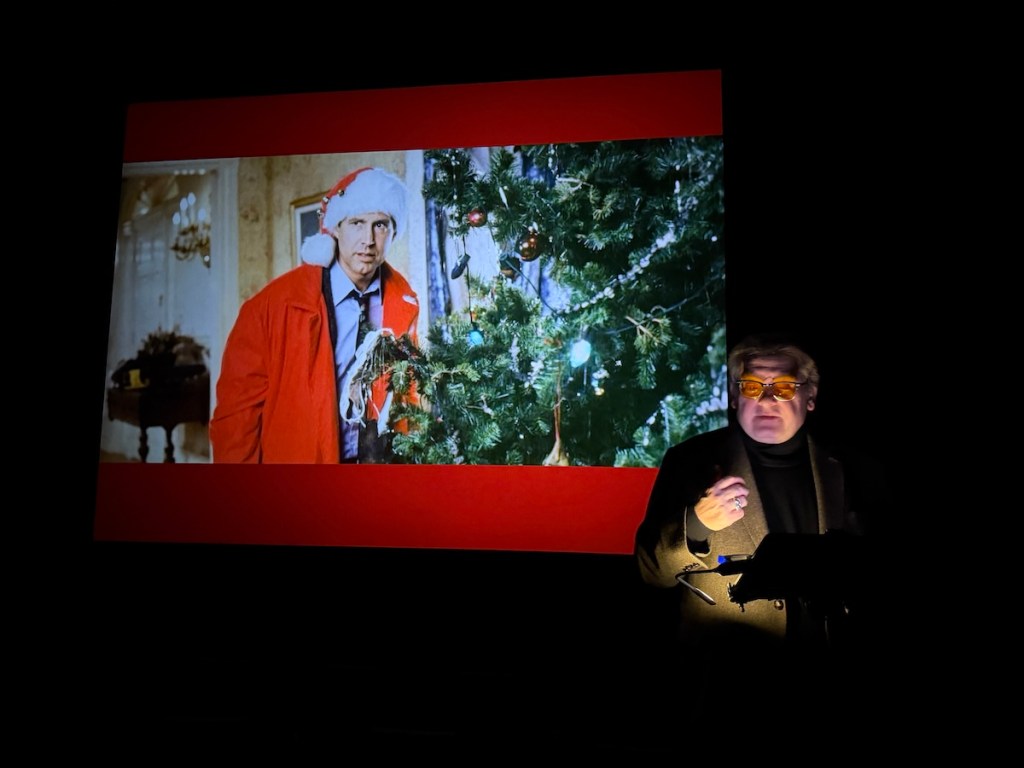Ich bin auf meinem Super 8-Tripp. Und ich habe einen meiner Lieblingsfilme Nosferatu von 1921 auf diesem wunderbaren Trägermedium.

Revue nahm die Träume der Kinozeit mit nach Hause, auf ratternde Projektoren und flackernde Leinwände im Wohnzimmer, und machte aus großen Stoffen kleine, greifbare Schätze für Sammler und Filmverliebte. In dieser Welt entstand auch die stark gekürzte Super‑8‑Fassung von „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“, die Anfang/Mitte der 1970er Jahre als schwarzweiße Stummfassung mit rund 66 Metern Länge in Deutschland erschien und als erster Titel die Reihe „Graf Draculas Gruselkabinett“ beim Label Revue eröffnete. Wo Murnaus Original von 1922 voller Schatten, Stimmungen und langsamer, unheilvoller Bilder ist, verdichtet die Super‑8‑Version das Grauen auf wenige Minuten – wie ein destillierter Alptraum, der nur die wichtigsten Szenen bewahrt und sie in ein neues, fast intimes Format überführt.
Die Schachteln dieser Reihe, beworben unter dem Namen Revue (Deutschland), wirkten wie Eintrittskarten in ein eigenes, kleines Parallelkino: Cover, Titel und Reihenname versprachen eine ganze Galerie des Schreckens, in der Nosferatu Seite an Seite mit anderen Monstern und Kreaturen stand. „Graf Draculas Gruselkabinett“ war weniger bloß eine Produktlinie als vielmehr ein Versprechen – dass man für ein paar Minuten im ratternden Lichtstrahl des Projektors den Alltag hinter sich lassen und in eine Welt aus Fledermäusen, Spukschlössern und fremden Welten eintauchen konnte.

Besonders reizvoll war die Art, wie Revue seine Titel kombinierte: Der gekürzte „Nosferatu“ wurde im Handel gemeinsam mit Filmen wie „Godzilla on Monster Island“ angeboten.
Wer eine solche Revue‑Fassung von „Nosferatu“ in Händen hielt, hielt nicht nur eine gekürzte Version eines Filmklassikers, sondern ein Stück gelebter Kinogeschichte fest – ein Relikt aus einer Zeit, in der man Filme nicht streamte, sondern sie als fragile Filmrollen besaß, sie vorsichtig einfädelte, den Raum abdunkelte und darauf wartete, dass der erste Lichtkegel die Leinwand traf. Jede Vorführung war ein kleines Ritual: das Klicken des Schalters, das langsam steigende Surren, die ersten flackernden Bilder des Vampirs mit seinen langen Fingern und dem gespenstischen Schatten, der sich über die Wand schiebt. In diesen wenigen, zusammengedampften Minuten lebten die Figuren weiter – und noch heute ist jede dieser Rollen ein stiller Zeuge dafür, wie groß die Sehnsucht der Menschen war, sich das Kino in die eigenen vier Wände zu holen.