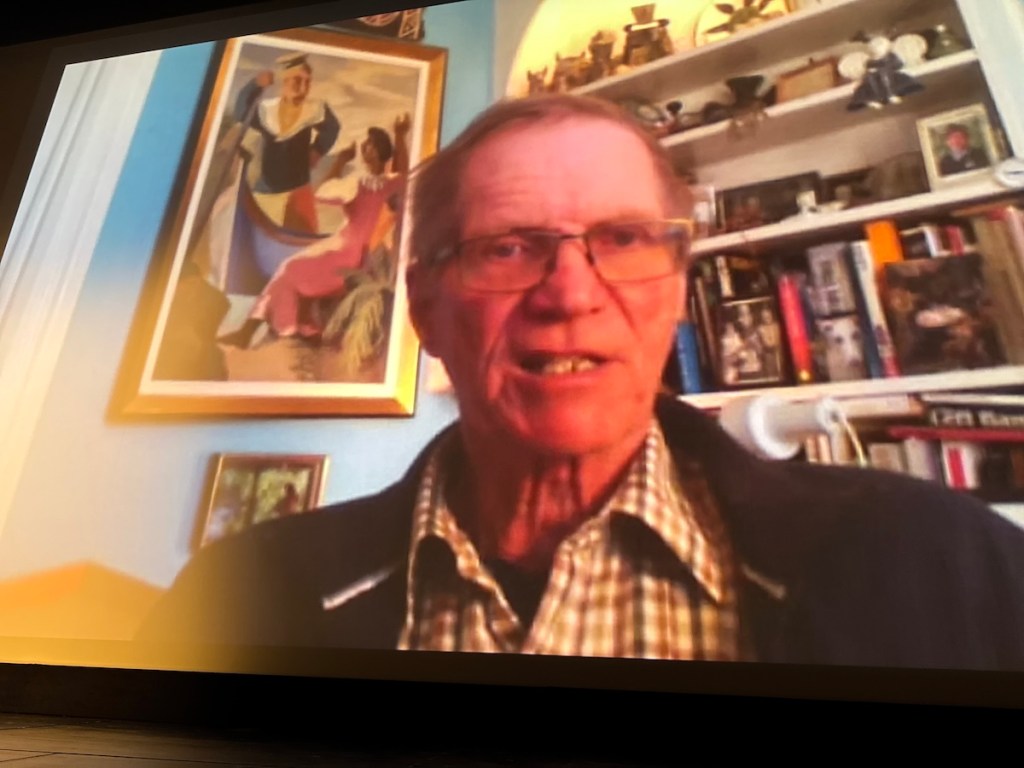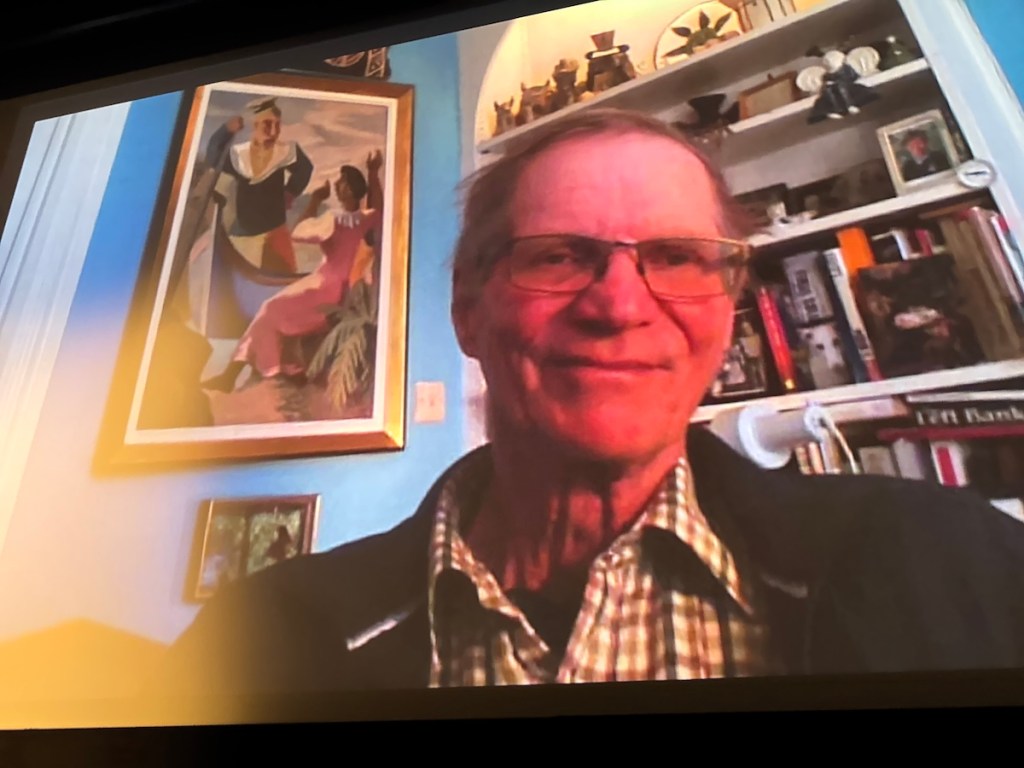„The Change“ ist eine Dystrophie in der Tradition von Civil War und Bob Roberts – und ich fühlte mich stark an Woody Allens Innenleben erinnert.

Selten fühlt sich Kino der letzten Jahre so nah, so bedrohlich, so kraftvoll an wie in Jan Komasas „The Change“. Von den ersten Momenten an spinnt der Regisseur ein Netz aus familiärer Nähe und schleichender Angst, das den Zuschauer förmlich einschnürt. Das Haus der liberalen, linken Familie Taylors, erfüllt vom Glanz einer alten, gewachsenen Liebe, wird zum Mikrokosmos des politischen Umbruchs: Ausgerechnet beim Fest zum 25. Hochzeitstag nimmt die Katastrophe Gestalt an. Mit der Ankunft von Liz, einer ehemaligen Studentin mit radikalen Visionen, verändert sich die Dynamik zwischen Eltern und Kindern, zwischen Vertrauen und Zweifel, zwischen Sicherheit und drohendem Abgrund. Die Zeiten ändern sich. Der Film ist ein Versuch eines Spiegelbildes des Wandels in den USA. Der Versuch eine konservative Revolution aufzuhalten und an diesem Wandel zugrunde zu gehen.
Komasas Handschrift ist spürbar. Wie schon in „Corpus Christi“ schaut er hinter Fassaden, tastet nach den Rissen in einer scheinbar heilen Welt. Der Film ist ein Dystopie-Drama, aber sein Schrecken entsteht nicht aus Fantasie, sondern aus der erschütternden Realität einer Gesellschaft, deren Werte ins Wanken geraten. Komasa zeigt: Die Monster sitzen oft nicht unter dem Bett, sondern am Tisch, getarnt als Ideologie – und entfalten ihre zerstörerische Kraft im Vertrauten, im Alltag. Die Kamera bleibt dicht an den Figuren, fängt Blicke, Flüstern und die feinen Verschiebungen im Miteinander ein. Der Ton ist mal nüchtern, mal beängstigend direkt – jede Szene trägt das Versprechen von Eskalation, aber nie lässt Komasa die Figuren zu bloßen Symbolen verkommen.
Die Schauspieler geben alles: Diane Lane als Ellen schwankt zwischen Hoffnung und Abwehr, Kyle Chandler gibt den Zweifler, den Zweikämpfer gegen den eigenen Stillstand. Phoebe Dynevor als Liz ist eine Provokation, wandelnd zwischen Verführung und Bedrohung. Der Zusammenprall der Generationen wird zum Spiegel der politischen Radikalisierung: Die Dialoge tun weh, weil sie so ehrlich, so verzweifelt, so menschlich sind. Thanksgiving, Familientreffen, Geburtstage – jeder Anlass wird zur Prüfstein. Am Ende bleibt die Frage nach Schuld und Versöhnung, nach Verlust und Widerstand. Komasas Film bietet keine einfache Antwort, sondern zwingt zum Mitfühlen, Mitdenken, Mitzittern.
„The Change“ ist mehr als ein Thriller: Es ist ein düsteres, höchst emotionales Stück Zeitbild, ein schmerzlich schöner Film, der noch lange nachhallt. Komasa findet die Tiefe im Alltäglichen, macht die Bedrohung sichtbar und stellt den Menschen ins Zentrum. Ein Werk für alle, die Kino als emotionale Zumutung begreifen – als Warnung, als Plädoyer für den Mut, sich nicht unterkriegen zu lassen.
Jan Komasas „The Change“ ist ein Film, der die politisch-dystopischen Themen in einer beklemmend nahen Gegenwart verankert. Die Geschichte der politisch eher linken Professorenfamilie, die unversehens zur Keimzelle einer revolutionären Bewegung wird, dient als Mikroskop für die Radikalisierung und Spaltung der Gesellschaft: Eine junge Frau – nach ihrer Exmatrikulation wegen antidemokratischer Thesen – entfacht mit der Bewegung „The Change“ einen Paradigmenwechsel, der das gesamte politische System Amerikas erschüttert.
Der Film analysiert die Ausbreitung faschistoider Ideologien nicht irgendwo in den Hinterzimmern der Macht, sondern dort, wo sie den Einzelnen unmittelbar erfassen: im engsten sozialen Gefüge der Familie. Diese Verlagerung ins Private macht die Bedrohung umso spürbarer, weil Komasa die Emotionalität des Alltags mit den Mechanismen totalitärer Umwälzung kontrastiert. Die Demokratie wird nicht an Wahlurnen verhandelt, sondern in den hitzigen und verzweifelten Gesprächen zwischen Eltern, Kindern und Gästen – selbst in der Unmittelbarkeit des familiären Zusammenseins ist sie fragil und gefährdet.
In der dystophischen Vision von „The Change“ verschwimmen die Grenzen zwischen Überzeugung und Manipulation, zwischen Fürsorge und Fanatismus. Die Bewegung fordert radikale gesellschaftliche Umwälzungen, die der Einzelne kaum noch selbst bestimmen kann. Wer nicht mitzieht oder sich widersetzt, wird ausgegrenzt – ein Motiv, das an historische und aktuelle autoritäre Entwicklungen erinnert. Der Film stellt dabei die Frage nach der Standhaftigkeit demokratischer Werte, wenn sie im emotionalen Ausnahmezustand zwischen Nähe und Verrat neu verhandelt werden müssen.
„The Change“ zeigt auf, wie Politik zur persönlichen Katastrophe werden kann, wenn sie den Raum zwischen Menschen erobert und radikale Ideologien selbst Liebes- und Lebensbeziehungen vergiften. Komasa blickt mit analytischer Härte und emotionaler Wucht auf eine Zukunft, die beängstigend real erscheinen kann. Die Dystopie bleibt dabei nicht abstrakt, sondern wird im privaten Mikrokosmos erschreckend konkret und menschlich erfahrbar.

Als ich in der Pressevorführung von The Change saß, fühlte ich mich unweigerlich an Woody Allens Meisterwerk Innenleben erinnert. The Change“ von Jan Komasa und Woody Allens „Innenleben“ (Interiors) verbindet ein feinsinniger Blick auf den Zerfall einer Familie, die im Schutzraum bürgerlicher Behaglichkeit mit existenziellen Erschütterungen und gesellschaftlichen Umbrüchen konfrontiert wird. Beide Filme verlagern große Themen – gesellschaftlichen Wandel, innere Leere, Unsicherheit – in die Intimität der vier Wände und machen die Familie zum Brennglas für Ängste, Ressentiments und Verstrickungen, die weit über das Private hinausweisen.
In „Innenleben“ spiegelt das kühle, stilisierte Interieur den emotionalen Stillstand, die Sprachlosigkeit und Isolation der Figuren. Allens Drama thematisiert den zerfallenden emotionalen Zusammenhalt und die Unfähigkeit, mit Veränderungen umzugehen. In „The Change“ greift Komasa diese Grundmotive auf, doch übersetzt sie ins Politische: Die Familie wird vom Sog einer radikalen Bewegung aus dem Gleichgewicht gebracht – die Zerrissenheit zwischen den Generationen, gegenseitiges Vorwerfen, Rückzug und Entfremdung eskalieren vor dem Hintergrund einer dystopischen Krise. Wie bei Allen sind es oft Blicke, Schweigen und alltägliche Rituale, in denen sich das Drama abspielt; die Macht der Atmosphäre, die beklemmende Präsenz unausgesprochener Konflikte ist beiden Filmen wesentlich.
Beide Werke erzeugen ihre emotionale Wucht durch die Kollision von Innen- und Außenwelt: Der Familienkreis wird zum Spiegel gesellschaftlicher Ängste und der Schwierigkeiten, Halt zu finden in Zeiten des Wandels. Während Allen seinen Figuren vor allem existenzielle Sinnsuche zumutet, setzt Komasa einen realen, politischen Umbruch als Treiber ein – doch in beiden Fällen stehen Entfremdung, Kontrollverlust und der Verlust von Stabilität im Mittelpunkt. Das Ergebnis ist jeweils ein Kammerspiel der Gefühle, dessen Eindringlichkeit weit über das Private hinausweist und zum Nachdenken über die Zerbrechlichkeit menschlicher Beziehungen anregt.