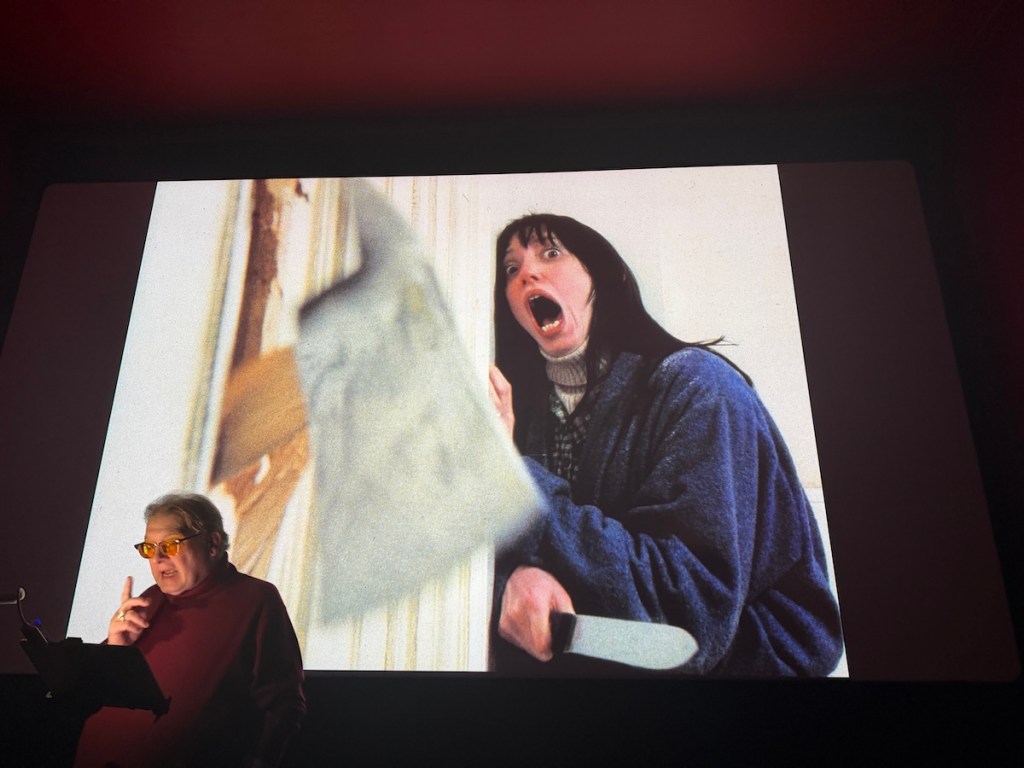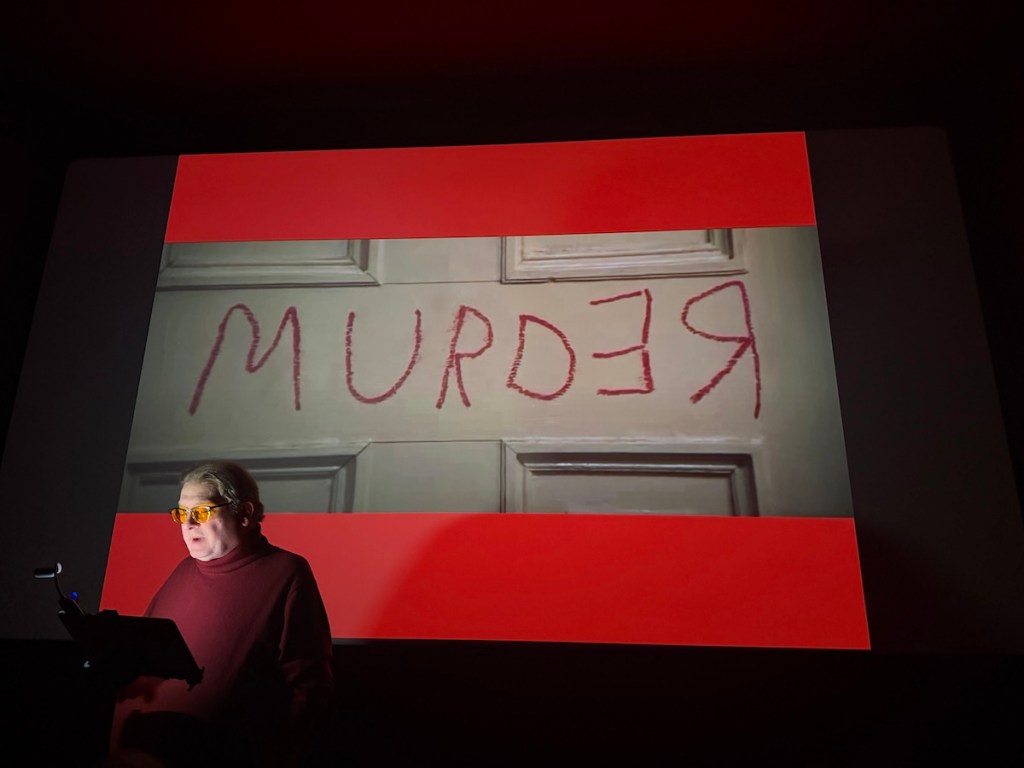Wenn ein Film mit einem Ford Mustang beginnt, kann es kein schlechter Film sein. So will es das Gesetz. Ich habe mich bei Return to Silent Hill getäuscht. Der Mustang reicht nicht. Die Spieleverfilmung von Christophe Gans („Pakt der Wölfe“) ist eine Tour de France von atemberaubenden, surrealistischen Szenen, die als einzelne Szene grandios wirken, aber auf Dauer nicht erschrecken, sondern ermüden. Zudem hat die ganze Sache mit dem Spiel kaum etwas zu tun. Und genau das ist das Problem bei diesen und vielen anderen Spieleverfilmungen.

Was dich als Spiel über Stunden oder Tage packt, funktioniert in diesem Fall nur bedingt auf der großen Leinwand als Film. Die Gamer werden diesen Film hassen, der die Faszination des Spiels zerstört. Damit reiht sich Return to Silent Hill in die Reihe der gescheiterten Videospielverfilmungen ein. Dabei wurde der Film inspiriert vom kreativen Geist des japanischen Videospiele-Visionärs Keiichiro Toyama.
„Return to Silent“ ist ein Film, der große Ambitionen erkennen lässt, diese aber in nahezu allen Bereichen verfehlt. Schon nach wenigen Minuten wird deutlich, dass Regie und Drehbuch keine gemeinsame Sprache finden: Während die Inszenierung sich in bedeutungsschweren Bildern verliert, die offenbar Tiefe suggerieren sollen, stapft das Drehbuch unbeholfen durch eine Aneinanderreihung von Klischees und unbegründeten Stimmungswechseln. Das Setdesign gibt sich alle Mühe, aber es reicht einfach nicht. Statt Spannung oder emotionale Wucht entsteht nur Verwirrung, und zwar der langweiligsten Sorte.
Die Figuren wirken wie aus Pappmaché geschnitten – flache Archetypen ohne erkennbare Motivation, die ihre Dialoge herunterleiern, als warteten sie nur auf den nächsten Szenenwechsel. Auch schauspielerisch bleibt alles blass: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Eve Macklin, Evie Templeton – niemand scheint wirklich an das zu glauben, was dort erzählt wird. Was haben die Drehbuchautoren nur aus dieser psychologischen Geschichte des Videospiels gemacht?

Musikalisch steigert sich das Desaster – der Score arbeitet gegen den Film, statt ihn zu tragen. Laute, pathetische Einsätze sollen fehlende Emotion ersetzen und betonen nur noch stärker, dass hier keine Geschichte zu erzählen ist. Selbst die Momente, die Spannung oder Atmosphäre andeuten, scheitern an ihrer aufgesetzten Symbolik. Die einzige Ausnahme bleibt natürlich nur Johann Sebastian Bach mit der Orchestersuite Nr. 3 in D-Dur, BWV 1068: Air, das der geneigte Filmfreund bereits aus Sieben kennt
Am Ende bleibt Return to Silent Hill ein Film, der so verzweifelt versucht, Bedeutung zu konstruieren, dass er über seine eigene Leere stolpert. Wenn man sich an das Spiel wirklich gehalten hätte, wäre alles gut geworden. Die Monster als Manifestation der Schuld des Helden wäre ein tolles Thema. Pyramid Head als Richter käme gut, aber hier geistert er nur herum. Der Film ist weder emotional noch intellektuell überzeugend, wirkt wie ein missglücktes Experiment, das seine Zuschauer mit der unangenehmen Frage zurücklässt, wie so viel Getöse um so wenig Inhalt entstehen konnte. Dabei habe ich so auf eine gute Videospielverfilmung gehofft.
Die erste „Silent Hill“-Verfilmung des französischen Regisseurs Christophe Gans spielte im Jahr 2006 weltweit über 100 Millionen Dollar ein und erreichte ebenso wie die zugrunde liegende Videospielreihe von Konami Kultstatus. Nun kam das Spiel Silent Hill 2 vor die Kamera und scheiterte, schade.

Besonders zu bemängeln ist die wirre und schwer nachvollziehbare Handlung sowie die fehlende emotionale Tiefe, obwohl sich der Film stark am psychologisch geprägten Silent Hill 2 orientieren soll. Statt subtiler Spannung setze der Film laut Kritik vor allem auf oberflächlichen Fanservice, etwa durch bekannte Figuren wie Pyramid Head, ohne deren Bedeutung sinnvoll in die Geschichte einzubetten. Positiv hervorzuheben ist die visuelle Gestaltung, das Setdesign und die grundsätzliche Atmosphäre, die stellenweise an die beklemmende Stimmung der Spiele erinnert. Insgesamt überwiegt mein Eindruck, dass „Return to Silent Hill“ sein Potenzial deutlich verfehlt hat und sowohl Neueinsteiger als auch viele langjährige Fans enttäuschen wird.